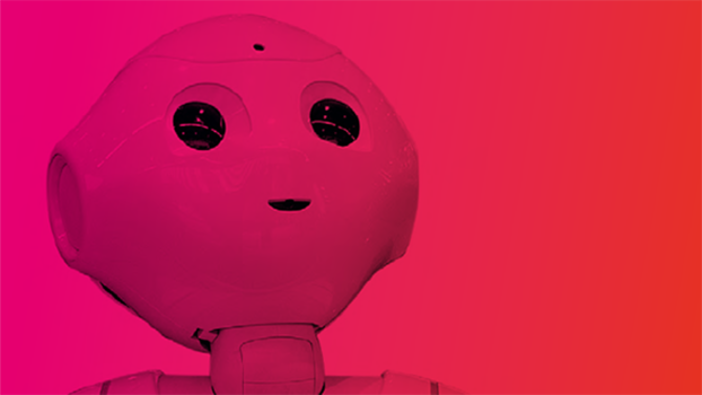Oliver, Du beschäftigst Dich mit dem «Geist des neuen Kapitalismus», mit dem, was uns – neben unserem Lohn – motiviert am Kapitalismus teilzunehmen. Hat sich dieser Geist denn in den letzten 200 Jahren verändert?
Das versuche ich gerade herauszufinden. Viele Menschen wollen heute mit ihrer Lohnarbeit nicht nur Geld verdienen, sondern auch etwas bewegen. Einige gründen sogar Firmen, und behaupten, sie wollten damit die Welt zu retten. Die reden wie Silicon-Valley-Gründer, wie Mark Zuckerberg, Peter Thiel und Elon Musk. Diese Milliardäre sprechen auch nie von Profiten, immer nur von Missionen und davon, wie sie den Menschen helfen. Das hat etwas Evangelikales: Steve Jobs wird als erleuchtet wahrgenommen, nicht einfach nur als Geschäftsmann. In Wirtschaftszeitungen wird er mit Heiligenschein dargestellt. Das hat mich als eher traditionellen Marxisten neugierig gemacht.
Wie repräsentativ ist das, was diese Silicon-Valley-Chefs sagen, für den Alltag der Menschen?
Ich beziehe mich bei meiner Suche nach dem neuen kapitalistischen Geist auf Max Weber und seinen Text «Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus» (1904/1905). Weber wird zwar immer als der Anti-Marx gesehen, trotzdem können wir viel von ihm lernen. Er hat sich – anders als Marx - für die kulturellen Grundlagen des Kapitalismus interessiert. Er wollte wissen warum die protestantischen Gebiete damals wirtschaftlich erfolgreicher waren als die katholischen. Im Anschluss an diese Beobachtung hat Weber seinen «Geist des Kapitalismus» aus Schriften von Martin Luther, Benjamin Franklin und Calvin entwickelt. Natürlich zeigt sich dieser kapitalistische Geist im Alltag der Menschen vielfältiger. Aber oft sind gerade auch die Abweichungen interessant.
Es gibt den neuen, kapitalistischen Geist also nicht nur im Silicon Valley. Wo hast du ihn noch angetroffen?
An sehr vielen Orten. Ich war zum Beispiel für drei Tage an der «Singularity University» in Berlin. Das war richtig spannend. Deutsche und internationale Unternehmen schicken dort Delegierte hin. Auch die haben nicht über Profite und Umsätze gesprochen. Stattdessen wurde mit Begriffen wie «disruptive Innovationen», «Fails» und «exponentiellen, singularistischen Technologieentwicklungen» jongliert. Da saßen Manager von Daimler, VW, Bosch und redeten als wären sie Startup-Gründer. Das hatte was von einem spirituellen Happening, einer Messe einer erleuchtenden Gemeinschaft – und passte gar nicht zu diesen Unternehmen.
Was bedeutet das für diese traditionellen Unternehmen denn im konkreten Alltag? Das sind ja keine Startups mit flachen Hierarchien und mit Kumpel-Kultur.
Die gründen alle Labs, Labore für Innovation. Sie versuchen die Unternehmenskultur des Silicon Valleys zu integrieren, weil die für neue, bessere Erfindungen, für Fortschritt steht. Sie betonen oft, wie wichtig es ist, scheitern zu dürfen, denn nur so entstehe neues; ein klassischer Silicon-Valley-Gedanke. Früher hatte man Angst vorm Scheitern. Jetzt nicht mehr. Der neue kapitalistische Geist ist hier der Treiber der Verwandlung von Unternehmen, deren Organisation eher zum 20. Jahrhundert gehört.
Oliver Nachtwey ist Professor für Sozialstrukturanalyse an der Universität Basel und Autor von «Die Abstiegsgesellschaft. Über das Aufbegehren in der regressiven Moderne» (Suhrkamp 2016) und «Die Ethik der Solution und der Geist des digitalen Kapitalismus» (2017, zusammen mit Timo Seidl). Das Interview führte Nina Scholz.
Gibt es das auch außerhalb der Wirtschaft?
Auf jeden Fall. Macron hatte zu seinem Amtsantritt gesagt: Frankreich muss wie ein Startup regiert werden. Das klang freundlich und frisch, war aber in Wirklichkeit eine Drohung. Und diese Drohung setzt er aktuell mit den neuen, neoliberalen Arbeitsgesetzen um.
Warum sind ausgerechnet die Vorstellungen aus dem Silicon Valley wichtig für uns geworden?
Weil die Kalifornier so gut darin waren, uns einen besseren, schöneren Kapitalismus zu versprechen, einen der nicht grau und bürokratisch ist, einen, der angeblich nicht ausbeutet. Gleichzeitig gab es das Versprechen der neuen Technologien: viele Menschen haben gehofft, dass diese die Gesellschaft verbessern und demokratisieren würden. Sie wollten an etwas teilhaben. Das wirkt bis heute nach.
Das Silicon Valley hat sein eigenes Versprechen aber nicht eingelöst.
Das Silicon Valley hat sich sehr verändert, die Arbeitsverdichtung hat zugenommen, die Arbeitsverhältnisse haben sich dramatisch verschlechtert, alles wurde viel stärker kommerzialisiert. Sie sind sogar vor Ort verantwortlich für hohe Immobilienpreise und Zwangsräumungen.
Und die Welt außerhalb Kaliforniens wurde auch nicht besser durch die Technologien.
Ja und nein. Einiges hat sich wirklich verschlechtert. Es wurde ein neues Cyberproletariat geschaffen, das stetig wächst. Die Deliveroo-Fahrer sind ein gutes Beispiel, weil man an ihren Arbeitsbedingungen sehen kann, wie viel Ausbeutung, wie viel algorithmisch gesteuerter, autoritärer Arbeitsprozess in den Technologien enthalten ist. Gleichzeitig verbessern diese Apps für viele Menschen den Alltag und die Organisation der sozialen Arbeitsteilung. Wir können besser miteinander kommunizieren, z.B. mit entfernten Freunden oder Verwandten schnell ein Skype-Video-Telefonat führen oder einfach leichter an gesundes Essen kommen. Diese Widersprüchlichkeit gehört zu den Technologien: Natürlich ärgere ich mich, wenn ich zum zehnten Mal meine Mails abrufe oder bei Twitter reinschaue. Ich empfinde es aber auch als spannende Welt der Kommunikation und könnte gar nicht darauf verzichten. Was im Silicon Valley erfunden wird, wirkt auf viele anziehend. Das ist nicht nur Ideologie.
Auch die Ursprünge waren widersprüchlich. Denn die Mission der ersten Silicon-Valley-Hippies war es, sich gegen Bürokratie und Autoritarismus aufzulehnen und Alternativen zum grauen Lohnarbeitsleben der Elterngeneration zu entwickeln. Das gab es auch in Deutschland. Du nennst das in Deinem Buch «Die Abstiegsgesellschaft» die «Künstlerkritik» der 68er. Sie dachten wirklich, sie verbessern die Welt.
Wenn man sich «68» erklären will, darf man nicht nur auf die Studierenden, man muss auch auf die Lehrlinge schauen. Ich komme aus einer katholisch-konservativen Familie. Mein Vater war 1968 Vorsitzender der örtlichen Jungen Union. Er hat aber auch eine Gewerkschaft gegründet. Einfach weil er es leid war, dass die Lehrlinge immer nur die Kisten schleppen mussten, dass sie keine Autonomie, keinen Gestaltungsspielraum hatten. Der Geist von 68 hatte auch Auswirklungen für die Provinz, für konservative Milieus und für Arbeiter. Das hat man auch in den Fabriken gesehen: bei den wilden Streiks, die damals stattgefunden haben, ging es plötzlich auch um Anerkennung, nicht mehr nur um Lohn. Ton Steine Scherben haben gesungen: «Ich will nicht werden, was mein Alter ist». Da heißt es: «Arbeit macht das Leben süß, so süß wie Maschinenöl. Ich mach den ganzen Tag nur Sachen, die ich gar nicht machen will.» Das trifft die Stimmung von damals auf den Punkt. Der proletarische Arbeiter sagt seinem Sohn: Du musst arbeiten. Und der Sohn sagt: ich will diese Fabriksirene nicht in meinem Leben haben.
Die Künstlerkritik der 68er wirkt bis heute fort und ist systemstabilisierend, bewirkt also das Gegenteil von dem, was sie eigentlich vorhat. Wie können wir dem entgegenwirken?
Die Kritik ist nach dem 2. Weltkrieg immer dann stabilisierend gewesen, wenn die explosive Synergie aufgelöst wurde, das heißt sie war sehr systemdestabilisierend als Künstlerkritik und Sozialkritik zusammenfielen und das war 1968 der Fall. Da ging es nämlich um neue Lebensformen, um Autonomie und um Befreiung. Da ging es aber auch um Sozialkritik und vor allem auch um eine globale Sozialkritik, gegen Ungerechtigkeit, gegen Ungleichheit und logischerweise wurde sich dann auch auf die Arbeiterfrage gestürzt. Nicht, weil der Arbeiter ein abstraktes Subjekt war, sondern weil sehr deutlich gesehen wurde, dass der Kapitalismus, trotz teilweiser Verbürgerlichung der Arbeiterklasse, immer noch ein System der Ausbeutung ist. Es war natürlich der Kampf gegen den Vietnamkrieg, es war natürlich eine antiautoritäre Bewegung, aber das soziale Moment, die soziale Frage war sehr zentral. Das kann man am Besten am Pariser Mai sehen, wo sich die Arbeiter mit den Studenten verbündet haben. In dem Moment, wo es dem Kapital gelungen war, Sozialkritik und Künstlerkritik zu trennen, wirkt die Künstlerkritik systemstabilisierend. Das Kapital hat im Anschluss an 68 erkannt, dass es die Kritik an den damals vorherrschenden Lebens- und Arbeitsformen nutzen könnte und hat diabolische Angebote gemachen: «Wir bieten Dir mehr Flexibilität innerhalb Deines Arbeitstages, aber dann ist auch Dein Vertrag flexibler» - was nichts anderes bedeutet, als weniger Absicherung. Das war ein langfristiger Prozess, der damals anfing. Heute haben wir uns an diese Verknüpfung längst gewöhnt. Wir müssen beide Kritikformen also wieder zusammenbringen, dürfen sie nicht gegeneinander ausspielen.
Der Kapitalismus ist heute ein Spezialist für diabolische Angebote. Ich denke zum Beispiel an die Smart-Home-Angebote, die das Leben zu Hause einfacher machen sollen, mit denen wir aber auch noch mehr überwacht werden.
Das ist eins der großen Rätsel. Warum weigerten sich Menschen bei der vergleichsweise harmlosen Volkszählung 1987 mitzumachen und jetzt können viele ihre Daten gar nicht schnell genug loswerden. Die Vorteile reizen natürlich, das Spielerische, das Futuristische, das Versprechen, das im Alltag vieles einfacher wird und die Daten sind vielleicht auch abstrakt, die Gefahr weiter weg.
Facebook und die Daten, die sie sammeln und weitergeben, stehen derzeit in der Kritik. Was meinst Du, wie es jetzt weitergeht?
Facebook wird vermutlich den «VW-Weg» beschreiten: erst gibt es die große moralische Empörung, dann ein wenig Strafe und später wird Facebook ungestört weiterwachsen. Genau wie bei VW wird auch Facebook weiter auf Kosten der Mehrheit Profite erwirtschaften – bis sie das nächste Mal erwischt werden.
Trotzdem wurde im Zusammenhang mit Facebook plötzlich von Enteignung und Verstaatlichung gesprochen. Wäre das überhaupt möglich?
Wir sollten den amerikanischen Kapitalismus nicht unterschätzen. Auch in seiner Geschichte gibt es Momente, wo die Monopole gebrochen wurden. Zum Beispiel wurde auch AT&T vor über 100 Jahren mal verstaatlicht. Das ist also möglich, aber nur zum Zweck des Wettbewerbs. Wenn es eine Regulierung von Facebook geben wird, dann nicht, weil die progressive Kritik an Facebook so stark geworden ist, sondern weil die Neoliberalen sich Sorgen um ihren Markt machen.
Du bist also für eine Verstaatlichung von Facebook?
Facebook ist kein normales Unternehmen mehr, sondern eine gesellschaftliche Institution, die fundamental für Meinungsbildung, Kommunikation, Debatten geworden ist und deswegen wäre es richtig Facebook zu vergesellschaften. Aber das alleine reicht nicht. Facebook muss auch demokratisiert werden. Wir wollen doch nicht, dass der Staat in seiner jetzigen Form Zugriff auf unsere Daten hat. Verstaatlichung ohne Demokratisierung ist der Weg zum Totalitarismus.
Wie sähe so eine Demokratisierung der Technologie-Unternehmen aus?
Die Eigentümerstruktur müsste grundlegend geändert werden. Das Ideal wäre eine internationale Genossenschaft...
... so wie es für Twitter schon mal vorgeschlagen wurde...
Genau. Die moderatere Forderung wäre Rundfunkräte für Facebook einzuführen, wo die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen drin vertreten sein müssen, die User, die Empfänger von Hassnachrichten, die Produzenten von Inhalten, so dass wir anerkennen, dass wir einen globalen Informationsraum bekommen haben, der den Menschen gehören muss und nicht ein paar wenigen.
Solche Ideen werden seit einiger Zeit vermehrt in der Linken diskutiert - eine positive Entwicklung. Gleichzeitig gibt es auch in der Linken eine Technikgläubigkeit, die der Publizist Evgeny Morozov als «linken Solutionismus» kritisiert.
Im Solutionismus existieren Klassen als Kategorie gar nicht mehr. Sie denken Gesellschaft vergleichbar zu einem Software-Programm. Es gibt Bugs, also Fehler, und die kann man für sich lösen. Das war in den alten Sozialtheorien noch anders: Die alten Sozialtheorien, egal ob Konservatismus oder Neoliberalismus, sind noch davon ausgegangen, dass es Klassen und Klassenkonflikte gibt. Der Neoliberalismus richtete sich zum Beispiel gegen die Gewerkschaften, gegen die Arbeiterbewegung und gegen ihre Errungenschaften. Auch der linke Solutionismus schaut nur auf die Probleme, und nicht auf die Ursachen. Es geht dabei nicht mehr um die Frage nach gesellschaftlicher Transformation und nach einer neuen Gesellschaftsordnung. Was umgekehrt nicht heißen muss, dass einzelne Vorschläge nicht trotzdem gut sind: ich finde mehr demokratischen Experimentalismus gut. Verschlüsselung ist so ein Beispiel. Das löst nur ein nur bestimmtes Problem, ist aber trotzdem eine gute Sache.
Teile der Linkspartei werben gerade massiv für das Bedingungslose Grundeinkommen. Ist das ein Beispiel für linken Solutionismus?
Das Grundeinkommen ist eine sympathische Idee. Darin steckt die Vorstellung, dass alle Menschen ein Leben frei von staatlicher Drangsalierung und mit Würde verdient haben. Ich würde das Grundeinkommen also nicht verteufeln. Aber Du hast Recht: es ist ein Gadget, es löst nicht die Probleme, die der Kapitalismus verursacht. Mit der Einführung des Grundeinkommens würde man vielleicht die Demütigungen von Hartz 4 abschaffen, aber gleichzeitig würde man auch den Sozialstaat mit den in ihm institutionalisierten Rechten abschaffen. Deswegen würde ich das Grundeinkommen beim linken Solutionismus und nicht bei der Frage, wie linke Transformation aussehen könnte, einordnen. Aber genau diese Frage müssen wir uns dringend stellen.